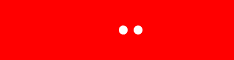(10.08.2012)
Die Deutsche Bahn AG hat sich das Ziel gesetzt, den Schienenverkehrslärm bis 2020 im Vergleich zum Jahr 2000 – auch unter Berücksichtigung erwarteter Verkehrssteigerungen - zu halbieren. Dieses Ziel kann nur mit einem Maßnahmenbündel erreicht werden:
- Fortsetzung des freiwilligen Lärmsanierungsprogramms des Bundes und der Lärmvorsorge
- Weiterhin Beschaffung neuer Güterwagen mit und Umrüstung der Güterwagen aus der Bestandsflotte auf die Verbundstoffsohle; Umsetzung des Pilot- und Innovationsprogramms des Bundes
- Erforschung und Entwicklung weitergehender Technologien zur Lärmminderung am Fahrzeug, am Gleis und in Kombination
Knapp 300 Millionen Euro aus dem freiwilligen Lärmsanierungsprogramm des Bundes hat die DB in den vergangenen Jahren für Lärmsanierungsmaßnahmen entlang der Rheinschiene umgesetzt. Über 138 Kilometer Schallschutzwände und passive Schallschutzmaßnahmen in rund 29.000 Wohnungen haben die Anwohner spürbar entlastet. Davon wurden 40 Millionen Euro im Bereich des Weltkulturerbes Mittelrheintal zwischen Koblenz und Bingen investiert. 11,5 Kilometer Schallschutzwände und zusätzlich passiver Schallschutz in rund 8.000 Wohnungen sorgen für den Lärmschutz entlang der Strecke. Derzeit sind noch rund 1,2 Kilometer Schallschutzwand im Bereich St. Goarshausen im Bau.
Die DB hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einsatz lärmmindernder Technologien an Fahrzeugen und am Fahrweg voran zu bringen und damit den Lärm an der Quelle zu bekämpfen.
Bereits seit 2001 hat die DB neue Güterwagen grundsätzlich nur mit K-Verbundstoffbremssohlen beschafft, wodurch sich das wahrgenommene Vorbeifahrgeräusch um rund 10 dB(A) vermindert, was als Halbierung des Lärms wahrgenommenen wird. Rund 7000 leise Güterwagen sind bei der Deutschen Bahn bereits im Einsatz. Darüber hinaus arbeiten Industrie, Eisenbahnunternehmen und Wagenhalter mit Nachdruck an einer kostengünstigeren Flüsterbremse, insbesondere der LL-Sohle, für die Umrüstung, die ohne technische Umbauten am Fahrzeug selbst einfach auszutauschen ist.
Die Technik ist derzeit in der konkreten Erprobung mit dem Ziel der europaweiten Zulassung und uneingeschränkten Nutzbarkeit. Hierfür wurde im Dezember 2010 mit mehreren europäischen Bahnen und Wagenhaltern der „EuropeTrain" gestartet. Er besteht aus 32 repräsentativen Wagen, die überwiegend mit LL-Sohlen ausgestattet sind. Noch bis Herbst 2012 wird dieser Modellzug Daten aus rund 200.000 Kilometer Fahrstrecke quer durch Europa sammeln. Dabei wird die LL-Sohle in der Praxis unter unterschiedlichsten topografischen, klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen auf ihre Auswirkung auf den Radverschleiß und auf das Fahrverhalten geprüft. Die letzte Erprobungsfahrt in Deutschland fand Ende April 2012 statt. Frankreich, Luxemburg und Italien stehen noch bis Mitte September auf dem Fahrplan des „EuropeTrain".
Im Rahmen des Projektes „Leiser Rhein" fördert die Bundesregierung mit 7,5 Millionen Euro außerdem die Umrüstung von 1.250 Güterwagen aus dem Bestand der DB Schenker Rail auf leisere Verbundstoff-Bremssohlen. Diese Umrüstung soll bis 2013 abgeschlossen sein.
Ergänzend zum Programm der Bundesregierung zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes wurde von 2009 bis 2011 aus dem Konjunkturprogramm II des Bundes die Erprobung von 13 innovativen Technologien finanziert. Ein Fokus des Programms lag hierbei auf Strecken für den Güterverkehr, insbesondere im Mittelrheintal.
Unter anderem wurden in den Bereichen Bingen, Oberwesel, St. Goar, Kaub und St. Goarshausen rund 22 Streckenkilometer mit Schienenstegdämpfern ausgestattet, die den Lärm schon an der Quelle vermindern sollen. Zusätzlich werden niedrige Schallschutzwände in Oberwesel, Bingen und Osterspai auf einer Länge von insgesamt rund 1,3 Kilometern erprobt. Im Raum Koblenz wurde Anfang 2010 auf der Lahnsteinbrücke eine Fahrbahntechnik mit elastischen Schienenbefestigungen eingebaut. Damit soll eine Übertragung der Schwingungen auf den Brückenkörper vermindert und so das Dröhnen der Lahnsteinbrücke reduziert werden. Bis Mitte 2012 soll der Bericht über die erreichte Lärmminderung der Maßnahmen vorliegen. Bewähren sich die neuen Techniken, können sie im Regelbetrieb angewandt werden.